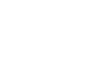Stimmung in der Werbewirtschaft verbessert sich
• Hoffnung auf Aufbruch und Aufschwung in Deutschland, konkrete Erwartungen gegenüber Bundesregierung
• Skepsis gegenüber den Ankündigungen aus Brüssel
Nachdem im November 2024 die Stimmung des ZAW-Trendbarometers mit 2,3 Punkten ein Allzeit-Tief erreicht hatte, zeigt sich nun im Frühjahr eine leichte Erholung. Mit einem Gesamtwert von 3,2 Punkten ist die Stimmung damit wieder auf dem Weg der Besserung. Insbesondere im Bereich der politischen Entwicklung schöpfen die befragten ZAW-Mitglieder wieder Hoffnung. So ist allein dieser Wert von 1,8 (November 2024) auf nunmehr 3,0 Punkte (April 2025) gestiegen (siehe Abbildung). Damit wird auch deutlich, welche Hoffnungen, aber auch Erwartungen sich mit einer neuen Regierung aus CDU/CSU und SPD verknüpfen.

Was die ökonomischen Erwartungen für das erste Halbjahr 2025 (im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024) angeht, bleiben die Befragten dennoch zurückhaltend. So erwarten mit 46 Prozent knapp die Hälfte der Befragten eine schlechtere wirtschaftliche Entwicklung als im ersten Halbjahr 2024. Rund 31 Prozent gehen von einer gleichbleibenden Entwicklung aus, während 23 Prozent eine positive Prognose abgeben. Das vergleichsweise sehr gute erste Halbjahr 2024 und die aktuell besonders große Unsicherheit angesichts der Zollkonflikte könnten erklären, warum die ZAW-Mitglieder für 2025 eher vorsichtig prognostizieren. Dazu passt die Zurückhaltung der Befragten hinsichtlich der Prognose der Bundesregierung vom Januar über ein einsetzendes Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent für 2025. Knapp zwei Drittel geben an, dass sie eine schlechtere Entwicklung für das Land erwarten. Kurz vor ihrem Amtsende sah sich auch die alte Bundesregierung gezwungen, ihre Prognose erneut zu revidieren: In der aktualisierten Schätzung von Ende April (nach der ZAW-Befragung) wird nun lediglich von einer wirtschaftlichen Stagnation im Jahr 2025 ausgegangen.
Beim Fachkräftemangel bleibt das Bild ähnlich wie in der letzten Befragung. Mehr als 90 Prozent der Befragten sehen sich einem mittleren bis großen Mangel an Fachkräften in der Branche gegenüber.
Produktive Wirtschaftspolitik bleibt große Sorge der Branche
Gefragt wurden die ZAW-Mitglieder auch, welche wirtschaftspolitischen Ziele aus ihrer Sicht für die kommenden zwei Jahre besonders wichtig sind, um eine positive ökonomische Entwicklung zu gewährleisten. Rund 90 Prozent der Befragten gaben dazu an, dass vor allem die EU-Gesetzgebung und damit verbunden der Abbau und die Vermeidung von Überregulierung, Bürokratie und Inkohärenzen zentral für eine positive Entwicklung sind. Die Verbesserung des Konsumklimas ist mit ebenfalls 90 Prozent gleichauf, dicht gefolgt von der Notwendigkeit, dass die Werberegulierung konsequent an marktwirtschaftlichen Prinzipien orientiert sein muss.
Im Trendbarometer wurde diesmal ferner danach gefragt, wie die ZAW-Mitglieder die Ankündigungen im Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission bewerten. Dabei wird klar deutlich, dass ein überwiegender Teil die angekündigten Maßnahmen als noch „unzureichend“ oder zumindest „ausbaufähig“ ansehen. Als „gelungen“ wollte hingegen keiner der Befragten die angekündigten Maßnahmen einordnen (siehe Abbildung). Ein klares Indiz, dass das Programm der Kommission nach Ansicht der Branche zu kurz springt, und zugleich ein Auftrag auch an eine neue Bundesregierung, in Brüssel darauf einzuwirken, dass das Brüssel mutigere Schritte für eine stabile und positive ökonomische Entwicklung in Europa unternimmt.

Konsistent zur vorherigen Abfrage verläuft die Entwicklung im Bereich der Nutzung von KI-Tools. Verglichen mit der Abfrage im November nutzen zwar gleichbleibend rund 50 Prozent der Befragten KI-Tools punktuell und im wachsenden Umfang. Allerdings sind inzwischen bei 41 Prozent der Befragten KI-Tools fester Bestandteil von Arbeitsprozessen. In der Befragung von November 2024 waren dies lediglich 28 Prozent. Entsprechend wird KI offenbar immer stärker ein etabliertes Tool im Arbeitsalltag der Branche. Neben den Chancen für Effizienz- und Wertschöpfungs-gewinne werden zunehmend auch die enormen Herausforderungen und Risiken für Geschäftsmodelle und den Wettbewerb deutlicher – und damit auch der Handlungsbedarf für die Politik.