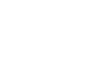Datenschutz
Das europäische wie nationale Datenschutzrecht hat sich so weit ausgedehnt, dass für nahezu alle kommerziellen Datenverarbeitungen eine komplexe, einzelfallbezogene Einwilligung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erforderlich ist. Die Versuche der Politik, Einwilligungsabfragen einzudämmen, sind auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Für die schiere Existenz werbefinanzierter Angebote im Netz und damit den Fortbestand eines freien Internets sind sie höchst bedeutsam
Geplant: Nationale Einwilligungsverordnung
Nach § 26 Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) besteht die Möglichkeit, eine Rechtsverordnung (EinwVO) zu erlassen, durch die Dienste zur Einwilligungsverwaltung anerkannt werden. Ein Referentenentwurf von Juni 2022 wurde nach breiter Kritik überarbeitet, der Entwurf von Juni 2023 wurde nach erfolgter Verbändeanhörung und Abstimmung der Ressorts der Bundesregierung zur Notifizierung an die EU-Kommission geleitet – ohne dass erneut Gelegenheit zu Reality-Checks gegeben wurde. Der ZAW hatte frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass eine EinwVO eine Reihe von Bedingungen beachten müsse, andernfalls werde es zu existenzbedrohenden Resultaten für die allermeisten Internetangebote kommen. So müsse das Prinzip der Freiwilligkeit der Einbindung von Diensten zur Einwilligungsverwaltung eindeutig in der Verordnung verankert sein und umfassend gelten. Schließlich gehe es um den geschützten Kernbereich der Kundenbeziehungen zwischen Internetangeboten und Nutzern und benötigte Geschäftsmodelle, um eine breite Verfügbarkeit digitaler Angebote refinanzieren zu können. Ebenso wichtig sei, dass weiterhin ein eigenständiges Einwilligungsabfrage- und -verwaltungsrecht von Telemedien gegenüber Einwilligungsmanagern gewahrt bleibe. Abfrageverbote, insbesondere für den Fall der Ablehnung von Einwilligungen und der Änderung von Geschäftsbeziehungen und Datenverarbeitungen mit Dritten, dürfen nach Ansicht des ZAW auch bei Einbindung von Einwilligungsverwaltungsdiensten nicht beschränkt werden. Der zwischenzeitlich bekannt gewordene Notifizierungsentwurf für eine nationale EinwVO ist in dieser Hinsicht verbessert, allerdings noch nicht hinreichend. Der ZAW wird mit seinen Mitgliedern den Gang der Beratungen weiterhin konstruktiv begleiten.
Wohl gescheitert: Cookie Pledge der EU-Kommission
Auch die EU-Kommission versucht noch vor der Europa-Wahl mit dem 2023 ins Leben gerufenen „Cookie Pledge“ der selbst verursachten Komplexität Herr zu werden. Als formal freiwillige Initiative konzipiert, hat sich im Verlauf der Beratungen jedoch herausgestellt, dass Grundprinzipien der Angebotsgestaltungsfreiheit in Frage gestellt wurden und die Anbieterseite durch weitgehend unpraktikable Selbstverpflichtungszusagen dazu bewegt werden sollte, auf legale und benötigte Datenverarbeitung zu verzichten. Nachdem Unternehmen und Verbände der digitalen Medien- und Werbewirtschaft auf die Mängel der Initiative, insbesondere die fehlende wirtschaftliche Evidenz der vorgelegten Verpflichtungszusagen, hingewiesen hatten, könnte sich die EU-Kommission auf den Standpunkt stellen, die Thematik müsse gesetzgeberisch angegangen werden. Angesichts der großen Sensibilität des Themas und der stark ideologisch geprägten Debatte sind für die Interessenvertretung der Branche erhebliche Herausforderungen zu erwarten.
Fragwürdige Politik von Aufsichtsbehörden
Das European Data Protection Board (EDPB) hat Leitlinien zum Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 3 der E-Privacy Verordnung herausgegeben. Diese weisen sowohl in rechtlicher als auch in praktischer Hinsicht erhebliche Defizite auf – darauf wurde durch den ZAW hingewiesen1 Ebenso veröffentlichte das EDPB im April 2024 eine Stellungnahme zur Zulässigkeit von sogenannten PUR-Modellen bei großen Online-Plattformen. Trotz deutlicher Warnungen seitens der Verbände vertrat das Gremium eine Position, die sich von der wirtschaftlichen Realität entfremdet: Demnach müssen große Online-Plattformen ihr Angebot stets auch kosten- und (werbewirtschaftlich) trackingfrei für die Nutzer bereitstellen (dritte Option). Der ZAW sieht hierin die Gefahr, dass diese (Rechts-)Auslegung auf die gesamte digitale Werbewirtschaft übertragen wird. | Stand: April 2024