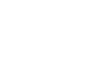Wirtschaft und Werbung
Die Werbewirtschaft trug 2023 mit einem Anteil von 1,2 Prozent zum BIP in Deutschland bei. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Marktvolumen um 1,5 Prozent auf rund 48,79 Mrd. Euro. Die Branche lässt damit die Jahre mit multiplen Krisen (Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise) hinter sich und verzeichnet ein leichtes Plus. Gehemmt werden weitere Steigerungen durch immer enger gezogene Überregulierung, die der Wirtschaft die Luft zur Entfaltung und für Investitionen abschnürt. Versprechungen der Ampel-Regierung zum Bürokratieabbau wurden bislang nicht eingehalten
Über alle Gattungen hinweg konnte die Werbewirtschaft 2023 ein Gesamtplus von 1,5 Prozent verbuchen. Die Segmente innerhalb der Branche entwickelten sich allerdings unterschiedlich. Nach einem Rückgang der Netto-Werbeeinnahmen der Medien im Vorjahr konnten die Nettoerlöse der Medien 2023 um 0,7 Prozent gesteigert werden. Dagegen sanken die Einnahmen durch weitere Formen kommerzieller Kommunikation um 0,8 Prozent. Im Vorjahreszeitraum waren sie noch um 5,5 Prozent gestiegen.
Mit 45,9 Mio. Menschen erreichte die Beschäftigtenzahl in Deutschland 2023 einen erneuten Höchststand. Die Inflationsrate blieb mit 5,9 Prozent zwar unter dem Vorjahr, ist aber aufgrund der Verteuerung von Lebensmitteln nach wie vor auf Rekordhöhe. Bedingt durch die hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen blieb die Konjunktur gebremst und sank gegenüber 2022 preisbereinigt sogar um 0,3 Prozent. Der private Konsum ging insbesondere aufgrund der hohen Verbraucherpreise um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Die fortgesetzte Konsolidierung bei den fundamentalen Marktdaten der Branche ist vor diesem Hintergrund erfreulich, aber natürlich fragil.
Laut der Prognose der Bundesregierung für 2024 wird das BIP lediglich um 0,3 Prozent wachsen. Damit befindet sich Deutschland am Rande der Stagnation. Erholung wird (erst) für 2025 erwartet, dann soll das BIP um 1,0 Prozent wachsen. Die Hoffnung: weiter sinkende Inflation und dadurch steigende Reallöhne. Wesentliche Wachstumsimpulse sollen außerdem von den privaten Verbrauchern ausgehen. Hier setzt man darauf, dass ein Rückgang der Inflation dazu führt, dass die Konsumzurückhaltung aufgebrochen wird und die krisenbedingte Unsicherheit der Verbraucher abnimmt. Die Konjunkturprognosen der privaten Institute im Frühjahr 2024 sind demgegenüber tendenziell pessimistisch, jedenfalls was eine echte Konsumaufhellung betrifft. Für 2024 wird eher mit einem Absinken des BIP gerechnet, während man eine minimale Steigerung im Jahr 2025 zumindest für möglich hält.
Der Werbemarkt 2023
Die Werbewirtschaft kann auch 2023 ein leichtes Plus verzeichnen und das sanfte Wachstum aus den letzten beiden Jahren fortsetzen. Mit einem Marktvolumen von 48,79 Mrd. Euro liegt der Werbemarkt in Deutschland über dem Vor-Coronawert von 48,33 Mrd. Euro. Die pandemiebedingte werbewirtschaftliche Rezession 2020 lag mit minus 7 Prozent höher als die der Gesamtwirtschaft (minus 5 Prozent). Aus diesem Tal konnte sich die Werbewirtschaft zwar herausarbeiten, für deutliche Sprünge nach oben fehlt es aber nach wie vor an den Rahmenbedingungen. Belastungen durch angekündigte drastische Werbeverbote und weiter bestehende gestörte Wettbewerbsbedingungen im Digitalbereich verhindern Wachstum für ganze Sektoren gerade in den Bereichen, in denen es potenziell (aufgrund des Mediennutzungsverhaltens) stattfinden kann. Die Möglichkeiten für ein kräftigeres Wachstum im Jahr 2023 wurden nicht wahrgenommen. Erfolgt hier kein Umsteuern – bei der fundamentalen Wirtschaftspolitik wie den fachspezifischen Vorhaben – sehen der ZAW und seine Mitgliedsverbände auch 2024 besorgt in die Zukunft der Werbe- und Medienlandschaft.
Die Gesamtinvestitionen in kommerzielle Kommunikation von 48,79 Mrd. Euro, die damit zum Vorjahr (48,09 Mrd. Euro) um 1,5 Prozent anstiegen, setzen sich zusammen aus den medienbasierten Investitionen in Werbung (36,98 Mrd. Euro), inklusive der Netto-Werbeeinahmen erfassbarer Werbeträger, sowie den weiteren Formen kommerzieller Kommunikation (11,81 Mrd. Euro). Bei den Netto-Werbeeinnahmen der erfassbaren Werbeträger konnte 2023 ein leichtes Plus von 0,7 Prozent verzeichnet und damit das Minus aus dem Vorjahr von 0,5 Prozent kompensiert werden. Die weiteren Formen kommerzieller Kommunikation (Werbeartikel, Sponsoring, Kataloge, sonstige Werbedrucke) mussten dagegen einen Rückgang um 0,8 Prozent hinnehmen, nachdem sie im Vorjahreszeitraum durch Nach-Pandemie-Effekte um rund 6 Prozent zugelegt hatten.

Mit ihrem Beitrag zur volkswirtschaftlichen Gesamtbilanz bewegt sich die Werbebranche weiter auf Augenhöhe mit Branchen wie dem deutschen Arzneimittelmarkt (Umsatz Arzneimittel in deutschen Apotheken 2023: 51,4 Mrd. Euro). Über ihre genuine Wertschöpfung, unter anderem durch Refinanzierung der Medienlandschaft, stellt sie den Hebel für alle anderen Branchen und erzeugt so weiteren volkswirtschaftlichen Public Value. Kommerzielle Kommunikation ist ein sehr effizienter Hebel für den Markterfolg von Innovationen und Transformationsprozessen und damit zukunftsgerichtetes Wachstum – Werbung ist unzweifelhaft ein Konjunkturbeschleuniger.
Jobangebote in der Werbebranche gehen 2023 zurück
Nachdem 2022 die Stellenangebote um 10 Prozent gestiegen waren, gingen die Angebote 2023 mit einem Minus von 39 Prozent deutlich zurück. Insbesondere die werbenden Firmen waren 2023 äußerst zurückhaltend, was die Suche nach Mitarbeitern im Bereich der Werbeberufe betrifft. Die größte Nachfrage besteht traditionell bei den Agenturen, die im Berichtsjahr rund 81 Prozent der Angebote stellten, vor den Werbungtreibenden mit 14 Prozent und den Medien mit 5 Prozent. Während bei den Agenturen Mediaexperten (561 Angebote), Mitarbeiter für Marketing und Werbung (532) sowie Auszubildende und Trainees (453) gesucht wurden, besteht bei den werbenden Unternehmen Bedarf für ausgebildetes Personal im Bereich Marketing und Werbung (450), Auszubildende und Trainees wurden nur wenige für diesen Bereich gesucht (24). Bei den Medien wurden in erster Linie Mediaexperten gesucht (83), Auszubildende oder Trainees lediglich 6.
Arbeitslosenzahlen steigen
Die Arbeitslosen im Bereich Marketing und Werbung stiegen um 20,1 Prozent von 25.160 in 2022 auf 30.217 im Jahr 2023 (jeweils Monat Dezember), so die Bundesagentur für Arbeit. Auch hier zeigt sich, dass die Werbewirtschaft sich weiterhin in schwierigen Zeiten befindet. Rund 900.000 Menschen sind in der Branche beschäftigt. Die Größe des Arbeitsmarkts ist beträchtlich, zum Vergleich: In der Automobilindustrie waren Mitte 2023 rund 780.000 Personen in Deutschland beschäftigt.
Konjunkturelle Entwicklung hemmt Wachstum der Agenturen mehr als Fachkräftemangel
Auch wenn der Fachkräftemangel für 63 Prozent der Agenturen noch ein Wachstumshemmnis darstellt, hat sich die Lage gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Hälfte der im GWA Frühjahrsmonitor 2024 befragten Agenturen hat aktuell mehr Festangestellte als noch im Vorjahr. Auch in der Agenturbranche hält Künstliche Intelligenz Einzug: 19 Prozent der Agenturen haben eigens dafür neues Personal eingestellt und versuchen auch auf diesem Weg dem Fachkräftemangel zu begegnen. Dank KI können einige Aufgaben effizient durch den Einsatz von Software erledigt werden. Als größte Wachstumsbremse sehen die Agenturen die aktuelle Konjunkturschwäche und die damit einhergehende Konsumzurückhaltung der Verbraucher.
Digitale Werbemärkte
Der Wettbewerb im digitalen Werbemarkt in Deutschland ist nach wie vor aufgrund der dominanten Marktposition einiger weniger Plattformen deutlich eingeschränkt. Da die Megaplattformen sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrageseite – teilweise auch gleichzeitig – oder gar marktübergreifend ihren Datenreichtum, Netzwerkeffekte und einseitige Regelsetzungsmacht zu Lasten des Wettbewerbs nutzen, führen diese Defizite und wirtschaftlichen Asymmetrien im Bereich der Online-Werbung zu erheblichen Nachteilen für alle anderen Akteure – Wettbewerber, Werbungtreibende und Verbraucher gleichermaßen. Auch aus diesem Grund profitierten 2023 erneut hauptsächlich die Megaplattformen vom Online-Werbemarkt.
Für 2024 wird prognostiziert, dass Google einen weltweiten Anteil von 27,4 Prozent am digitalen Werbemarkt erreichen wird, gefolgt von Meta mit 21,9 Prozent.
Immerhin ist der Digital Markets Act (DMA) in Kraft getreten und die EU-Kommission arbeitet an der Implementierung seiner Vorgaben. Inzwischen ist auch das vom ZAW und seinen Mitgliedern beschwerdeweise initiierte Verfahren nach § 19a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gegen Apple weiter vorangeschritten. Die erste Stufe des zweistufigen Verfahrens ist abgeschlossen, die hiergegen gerichtete Klage von Apple liegt dem BGH zur Entscheidung vor. Im Anschluss an die bald zu erwartende BGH-Entscheidung ist mit einer förmlichen Sachentscheidung des Bundeskartellamts zu rechnen. Schließlich hat die EU-Kommission Ende 2023 eine Abmahnung gegen Google im Rahmen der seit 2021 anhängigen Verfahren zu verschiedenen Sachverhalten auf dem Online-Werbemarkt, darunter auch der Sandbox-Initiative, ausgesprochen. Der ZAW unterstützt dieses Verfahren, bei dem die europäischen Wettbewerbshüter strukturelle Maßnahmen, also die Zerschlagung der marktdominanten und vielfach selbstbegünstigenden Aufstellung von Google verlangen. Mit Blick auf die vom Konzern angekündigten Sandbox-Pläne hat die Kommission zu verstehen gegeben, den gleichen Maßstab anzulegen. Dies ist sicherlich richtig.
Investitionen in Werbung 2023
Die medienbasierten Investitionen in Werbung stiegen um 2,2 Prozent auf 36,98 Mrd. Euro (2022: 36,18 Mrd. Euro). Die Netto-Werbeeinnahmen machen etwa 70 Prozent der Investitionen in Werbung aus. Bei hoher Inflation auch im Jahr 2023 konnten nominelle Preissteigerungen nicht (durchgehend) von den Werbeträgern weitergegeben werden. Das Bild bei den Nettodaten fällt sehr gemischt aus: Von den erfassten Werbeträgern schnitten einige – darunter auch der gesamte Digitalbereich – (deutlich) positiver als 2022 ab. Hauptnutznießer waren hier allerdings erneut die dominierenden Plattformen, während andere Publisher weitaus schwächer vom starken digitalen Plus profitieren konnten. Positiv entwickelten sich auch Kino- und Außenwerbung. Ein Werbeträger (Radio) stagnierte, alle anderen, namentlich der Printbereich und TV, mussten teilweise deutliche Rückgänge verkraften.
BIP-Anteil der Werbung im Jahr 2023
Mit knapp 49 Mrd. Euro erreichte die Werbewirtschaft einen Anteil von 1,2 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Den Beitrag, den die Werbewirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt leistet, hat die DIW-Econ-Studie „Gesamtwirtschaftliche Effekte der Werbung“ 2016 im Auftrag von ZAW und GWA in quantitativer und qualitativer Hinsicht empirisch belegt. Eine zentrale Aussage der Studie lautet: Werbeinvestitionen haben nicht nur einen direkten Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt, der Betrag verdreifacht sich beim BIP-Wachstum: 100 Mio. Euro Ausgaben für Werbung lösen einen Anstieg des BIPs um 300 Mio. Euro aus – mit entsprechenden wohlstandsbildenden konjunkturellen Effekten. 2023 gab es mit dem Anstieg der Investitionen in Werbung einen entsprechend positiven Effekt auf das BIP: Da die Investitionen in Werbung um 2,2 Prozent bzw. 0,80 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr stiegen, bewirkte dies einen Positiveffekt von 2,4 Mrd. Euro auf das BIP.

Umfangreiche Werbeverbotsdrohungen des BMEL belasten die Branche zusätzlich
Seit Anfang 2023 beschäftigt – neben einer ohnehin angespannten Konjunktursituation – ein angekündigtes umfassendes Werbeverbot für den Großteil der am deutschen Markt befindlichen Lebensmittel die Werbe- und Medienbranche: Ende Februar 2023 hatte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) einen Entwurf für ein Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz (KLWG) vorgelegt. Betroffen wären von dem dort geforderten umfassenden Werbeverbot nahezu alle Werbeträger: TV, Radio, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Out of Home (Plakat, Transport Media, Ambient Media und At-Retail Media) und Online-Werbung. Da es in weiten Teilen um pauschale Verbreitungsverbote und nicht um an Kinder gerichtete Werbung geht, wären die Folgen insbesondere für die Refinanzierung von TV und Radio, Presse sowie Außenwerbung dramatisch. Der Entwurf wurde mittlerweile mehrfach überarbeitet, enthält aber gleichbleibend ein überschießendes Werbeverbot.
Das Vorhaben ist innerhalb der Bundesregierung hochumstritten – wegen der drastischen wirtschaftlichen Folgen, insbesondere für Medien und die mittelständische Lebensmittelwirtschaft, der evident für weite Teile des Vorhabens fehlenden Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes, der mangelnden Evidenz für die Wirksamkeit von Werbeverboten und der damit einhergehenden Unverhältnismäßigkeit. Zudem stellt es eine deutliche Überschreitung der Vereinbarung des Koalitionsvertrags dar. Ob der Gesetzentwurf noch umgesetzt wird, ist fraglich. Bereits die Androhungen von überschießenden Werbeverboten hat jedoch für große Unsicherheit im Markt gesorgt.
ZAW-Trendanalyse Frühjahr 2024
Die ZAW-Trendanalyse zeigt eine weiter besorgte Einschätzung der konjunkturellen und werbewirtschaftlichen Erwartungen. Die Mehrheit befürchtet Stagnation oder gar einen Rückgang der Werbekonjunktur: 42 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden ZAW-Mitglieder erwarten für das Gesamtjahr 2024 eine schwarze Null, 18 Prozent rechnen mit einer schlechteren Entwicklung, 39 Prozent hingegen sehen Chancen für eine verglichen mit 2023 positive Entwicklung. Diese Tendenz zeigt sich auch in den Erwartungen für das erste Halbjahr 2024.
Die Arbeitsmarktsituation ist aus Sicht fast aller ZAW-Mitglieder problematisch: Rund 47 Prozent der Mitglieder beklagen weiterhin einen großen bis sehr großen Fachkräftemangel, ebenso viele einen mittelgroßen und nur 6 Prozent einen geringen. 75 Prozent geben an, dass die Lebensmittelwerbeverbotspläne des BMEL bei ihren Mitgliedern Arbeitsplätze sicher bzw. sehr wahrscheinlich gefährden – 46 Prozent der ZAW-Mitglieder sehen zudem, dass die Pläne ihre Geschäftsentwicklung stark bzw. sehr stark beeinflussen werden.
Die betrieblich unternehmerische Situation sehen die ZAW-Mitglieder kritischer als noch im Vorjahr: 47 Prozent befürchten Insolvenzen (2023: 33 Prozent), 57 Prozent gehen davon aus, dass es Fusionen geben wird. Sorgen bereitet ihnen außerdem das für die Branche so wichtige Konsumklima: Nur 3 Prozent schätzen es als positiv ein, 41 Prozent als mittelmäßig und mit 56 Prozent mehr als die Hälfte als schlecht. Immerhin, gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine spürbare Verbesserung dar (2023: 78 Prozent).
Die Antwort auf die Frage zur aktuellen Stimmung in der Werbebranche auf einer Skala von 8 = ausgezeichnet bis 1 = bedrohlich zeigt im Frühjahr 2024 mit 3,1 Punkten einen nahezu identischen Durchschnittswert wie in der Herbstwelle 2023 (3,2 Punkte). Aufgeschlüsselt nach Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ergeben sich für die wirtschaftliche Situation gleichbleibend 3,6 Punkte, zur politischen Lage nochmals schlechtere 2,3 Punkte (Herbst 2023: 2,5 Punkte) sowie gesellschaftlich 3,3 Punkte (Herbst: 3,4 Punkte). Die weiterhin historisch niedrigen Werte können als Echo auf die wirtschafts- und werbepolitische Regierungsarbeit aufgefasst werden. | Stand: April 2024