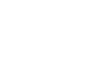Sebastian Lambeck neuer Leiter Kommunikation beim ZAW
Neuer Leiter Kommunikation beim ZAW
Sebastian Lambeck (40) ist neuer Leiter Kommunikation beim ZAW und tritt damit die Nachfolge von Anne Grote an, die den Verband Ende 2023 verlassen hat. Der Politikwissenschaftler kommt von der gematik, der Nationalen Agentur für Digitale Medizin, wo er seit 2022 Referent für (Krisen-)Kommunikation war. Zuvor hatte er seit 2019 die Leitung Presse & Kommunikation bei der Allianz deutscher Produzenten (Film & Fernsehen) inne.
Seine Laufbahn startete Sebastian Lambeck nach dem Studium an der Leibnitz Universität Hannover (BA) und der Freien Universität Berlin (MA) 2011 bei einer Klimaschutz-Agentur, gefolgt von Stationen im Gesundheitswesen, im Verbraucherschutz und Kulturbereich.
Dr. Bernd Nauen, ZAW-Hauptgeschäftsführer: „Wir freuen uns sehr, mit Sebastian Lambeck einen Leiter Kommunikation an Bord zu haben, der umfassende Erfahrungen und Fachwissen mitbringt – sowohl auf der Seite von NGOs als auch der Wirtschaft. Ich danke an dieser Stelle noch einmal Anne Grote für die jahrelange gute Zusammenarbeit und wünsche ihr im neuen Job nur das Beste.“